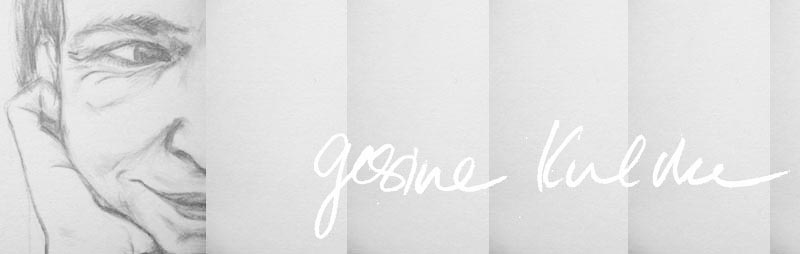
Höllenfahrt gen Osten
erschienen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 12. Februar 2004 mit dem Titel: Kein Vergleich zum Winter achtundachtzig
Schwarze Nacht am Moskauer Bahnhof. Auf dem Gleis steht ein dunkelgrüner Zug mit Schornsteinen, aus denen Dampf aufsteigt, wie gemalte Watte. Vor unserem Abteil wartet eine Art Miss Marple in blauer Uniform, auf den Schulterkappen Respekt einflößende Abzeichen. Sie lächelt und zeigt eine komplette Goldzahnreihe, die an ihrem Oberkiefer glänzt. Sie reißt unsere Fahrkarten ein, Stanislav und ich steigen in den Zug. Es sieht aus wie in einem Lazarett: Es gibt keine Abteile, dreißig Schlafpritschen befinden sich im Wagon, in jeder Lücke eine! Ich will sofort wieder aussteigen. Auf einer Pritsche sitzt ein alter Mann mit Tränen in den Augen. Ihm hat gerade jemand eine schwere Tasche mit Rollen übers Bein gezerrt, seine Hose aufgerissen, ist einfach weiter, ohne ein Wort zu sagen. Die Finger des alten Mannes kneten den Stoff, versuchen das nackte Knie zu verstecken.
Am Zugfenster ziehen zerfallene Häuser vorbei, überdacht mit Wellblech, ohne Putz. Die Vorgärten sind mit verschlammten Wasserlachen und vor sich hingammelnden Autowracks übersät. Jede Menge Bilder, in die das Hirn Elend spinnt: Menschen, die in ihren Gartenlauben verhungern und verwesen, in Kloaken ersaufen. Die Mitreisenden aber sagen, was wir da draußen sehen, habe mit Krise nichts zu tun, sei völlig normal. Kein Vergleich zum Winter achtundachtzig. Um nicht zu verhungern musste damals selbst der Moskauer, der mit befranster Lederweste überm Bierbauch von seinen drei Motorrädern schwärmt, im Wald Elche schießen gehen.
Es riecht nach hartgekochten Eiern und Krakauer. Frauen lösen zwischen Eierschalen und Wurstpellen Kreuzworträtsel. Ganz selbstverständlich tragen sie die gewaltigen Blumenmuster auf ihren Morgenröcken, ziehen an den Pritschen vorbei, zum Klo, zum Teekessel und wieder zurück, vorbei an schnarchenden, kahlgeschorenen Männerköpfen. Ich döse, bis plötzlich vor meiner Nase ein Fisch baumelt. Ich kralle mich an meinen klebrigen Rubeln fest, von links und rechts stapfen sie mit geräuchertem Fisch, Butter gefüllten Gläsern und in Zeitungspapier eingewickelten Nüssen an den Bettenlagern vorbei. Ein Mitreisender wettet, dass er für hundert Rubel, das sind drei Euro, eine lebende Ziege bekommt. Schneeweiß ist sie, kötelt und pisst vor Aufregung den ganzen Wagon voll. Eine Frau, die von ihrer Farm im Kaukasus erzählt, drückt sie sich zärtlich an den Hals. "Ich habe schon immer von einer kleinen Ziege geträumt." Die Zugpolizei stampft durch die Ziegenkötel, verlangt Pässe und holt einen Mann von seiner Liege. Er muss seine mit Wurstbroten und alten Socken gefüllte Tasche ausleeren.
Nach 36 Stunden sitzen die Haare der Frauen wie frisch gefönt. Eine Stunde vor unserer Ankunft in Vladikavkaz tauschen sie ihre Morgenröcke mit frisch gebügelten Blusen aus, die sie aus ihren Koffern zaubern, pudern und tuschen ihre Gesichter, malen die Lippen knallrot an.
Vladikavkaz. Die Häuser zerfallen, sie haben hoffnungslose, leere Gesichter wie ihre Bewohner. Zinn wurde hier mal geschmolzen und Silber raffiniert. Aber seit dem Zerfall der Sowjetunion haben sich die Fabrikgelände in unheimliche Geisterstädte verwandelt. In Vladikavkaz wird nur noch Schnaps gebrannt, erzählt Stanislavs Freund Arthur, der uns vom Bahnhof abholt. Das bringt Geld. Im Supermarkt gibt es alles zu kaufen, auch Becks und Joghurt von Ehrmann. Nur hundert Kilometer von Grozny entfernt. Arthur ist mit seiner Mutter und seinem Bruder aus der tschetschenischen Hauptstadt geflüchtet, die im Dezember 1999 in nur wenigen Tagen von den Russen dem Erdboden gleich gemacht worden ist: die erste komplett zerstörte Hauptstadt seit Warschau 1944.
Arthur begleitet Stanislav und mich zur Passstelle. Wer sich als Tourist nicht meldet, macht sich strafbar. Hinter dem Sperrholztresen zerren drei Damen in olivgrünen Tarnanzügen Blusen aus Plastiktüten und freuen sich laut lachend über ihre gerüschten Schnäppchen. Stanislav legt unsere Pässe auf das Sperrholz. Die Damen nehmen Haltung an, bewölken ihre Gesichter: "So kann ich Sie nicht registrieren, wo soll ich denn da hinstempeln?", donnert es aus dem dicksten der drei Tarnanzüge. Ich habe den Einreisezettel verloren, den mir am Moskauer Flughafen eine der Damen vom Zoll in den Reisepass gesteckt haben soll, ein kleines weißes Zettelchen, kaum größer als ein Kassenbon. "Und wo übernachten Sie? Suchen Sie sich erst mal ein Hotel!" Wir nehmen ein Zimmer mit taubenblau gestrichenen Wänden. Alles sauber, alles fein bewacht: Uniformen, die in der Lobby fern sehen; Uniformen, die vor dem Hotel rauchen oder mit Maschinengewehren den Verkehr regeln.
Wir laufen durch die Stadt, suchen ein Internetcafé. Die Leute bleiben stehen, drehen sich um, lachen uns aus. Eine riesige Stalin-Statue im Stadtpark scheint uns mit ihren Glubschaugen zu verfolgen. Ihre Augen bohren sich in unsere Rücken, bis wir die Stadt verlassen haben. Wir besuchen Arthur in Nazran, die Hauptstadt von Inguschetien, nicht weit von Vladikavkaz. Tanten, Onkel, Brüder, alle sind sie da, mästen uns mit Bergen von Rindfleisch, Gemüse, Käse, Kuchen und Geschichten von Bombenangriffen auf Grozny. Sie erzählen von Mord, Vergewaltigung und Folter, von ausgerissenen Fingernägeln, von abgerissenen Armen und Beinen, von neunzigtausend Tschetschenen, die seit vier Jahren in Flüchtlingslagern leben. Zum Abschied gibt’s drei Gläser mit eingemachtem Gemüse und Kompott.
Auf der Rückfahrt hocken wir stumm im Bus. Ich lasse mich fallen, träume von zu Hause, denke an den Basilikum, der auf meiner Küchenfensterbank vertrocknet. Stanislav packt seine Kamera aus, macht Aufnahmen durch das Rückfenster. Grau und verstaubt ist die Straße, ein paar Plastikflaschen und Tüten tanzen durch den fegenden Wind, ein Mann mit Fellmütze rührt mit einem dünnen Stock durch die Luft, brüllt irgendwas, vor ihm stolpern zehn Ziegenböcke über die Straße. Immer wieder öffnen sich Türen von scheinbar verlassenen Häusern, Frauen in Stöckelschuhen machen sich auf den Weg, dorthin wo es angeblich etwas zu kaufen gibt, kehren mit vollen Taschen zu ihren stummen Häusern zurück, kochen, trinken Tee und leben darin. Vor einem verlassenen Fabrikgelände hockt ein altes Ehepaar in einem Auto, auf der Motorhaube liegen in einem Korb ein paar rote Äpfel, die sie verkaufen wollen.
Plötzlich wird die Bustür aufgeschoben. Passkontrolle. Der Basilikum welkt weiter in meinem Hirn, während ich völlig unbeteiligt beobachte, wie Stanislav versucht, den Soldaten irgendetwas zu erklären. Nach fünf Minuten gibt er auf. "Die wollen uns mitnehmen." Ich öffne die Tür von einem weißen Lada, in dem uns ein Soldat aufs Polizeirevier bringen will. Stanislav redet und redet. Ich verstehe nichts, kann kein Russisch, gucke nach draußen, sehe die grauen Straßen vorbeiziehen, alles ganz normal. Warum schwitze ich nicht vor Angst? Ich sitze da, als ob uns ein netter Russe zu sich nach Hause eingeladen hat.
Auf dem Polizeirevier erwarten uns drei Männer. Sie lächeln. Alles wird gut, denke ich. Dann brüllen sie los, unsere Papiere seien nicht in Ordnung. Stanislav zeigt unsere Visa, alles da. Nein, es fehlen Papiere. Was wir in Vladikavkaz überhaupt zu suchen haben, wollen sie wissen. Wir sind Touristen, erzählt Stanislav, haben ein paar Freunde besucht. Dann fällt ihm der Einreisezettel ein, den die Damen in der Passstelle abgestempelt haben. Er zeigt ihn vor. Alles in Ordnung. Die Männer klopfen Stanislav auf die Schulter. Der Soldat, der uns zum Revier gefahren hat, begleitet uns zu seinem Wagen. Auf dem Beifahrersitz hocken noch die Einmachgläser mit unserem Gemüse und dem Kompott. "Haben wir von unseren Freunden geschenkt bekommen." Der Soldat lacht. Er schüttelt Stanislav die Hand, wünscht eine gute Reise, dreht sich zu mir um, starrt mich an: "Hat die eigentlich auch so einen Zettel?" Stanislav guckt verständnislos. "Na, den, den du uns gerade gezeigt hast. Hat die auch einen?" Stanislav wühlt in seinen Taschen. "Mitkommen", schnaubt der Soldat. Wir stolpern hinter ihm her und landen vor der Passstelle. Die Tarnanzüge, denke ich noch, da fängt der Soldat schon wie wild an, gegen das Fenster zu hämmern. Er ruft irgendetwas, doch keiner meldet sich.
Ich starre in den feisten Nacken des Soldaten, der nicht aufhören will, gegen die Scheibe zu trommeln. Der Nacken färbt sich rot. Der Soldat dreht sich um. Überlegt kurz und sagt dann ganz ruhig: "Okay, das war’s. Ihr könnt’ gehen." Tritt ab von der Bühne, hat keine Lust mehr, lässt uns mit rasenden Herzen stehen. Mit weichen Knien bewegen wir uns auf den Stadtpark, Stalin glotzt, allgegenwärtige Macht der Willkür. Erst als ich zwei Wochen später zu Hause meinen vertrockneten Basilikum in den Müll schmeiße, fühle ich mich wieder sicher.
Der Text ist urheberrechtlich geschützt.
zurück
erschienen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 12. Februar 2004 mit dem Titel: Kein Vergleich zum Winter achtundachtzig
Schwarze Nacht am Moskauer Bahnhof. Auf dem Gleis steht ein dunkelgrüner Zug mit Schornsteinen, aus denen Dampf aufsteigt, wie gemalte Watte. Vor unserem Abteil wartet eine Art Miss Marple in blauer Uniform, auf den Schulterkappen Respekt einflößende Abzeichen. Sie lächelt und zeigt eine komplette Goldzahnreihe, die an ihrem Oberkiefer glänzt. Sie reißt unsere Fahrkarten ein, Stanislav und ich steigen in den Zug. Es sieht aus wie in einem Lazarett: Es gibt keine Abteile, dreißig Schlafpritschen befinden sich im Wagon, in jeder Lücke eine! Ich will sofort wieder aussteigen. Auf einer Pritsche sitzt ein alter Mann mit Tränen in den Augen. Ihm hat gerade jemand eine schwere Tasche mit Rollen übers Bein gezerrt, seine Hose aufgerissen, ist einfach weiter, ohne ein Wort zu sagen. Die Finger des alten Mannes kneten den Stoff, versuchen das nackte Knie zu verstecken.
Am Zugfenster ziehen zerfallene Häuser vorbei, überdacht mit Wellblech, ohne Putz. Die Vorgärten sind mit verschlammten Wasserlachen und vor sich hingammelnden Autowracks übersät. Jede Menge Bilder, in die das Hirn Elend spinnt: Menschen, die in ihren Gartenlauben verhungern und verwesen, in Kloaken ersaufen. Die Mitreisenden aber sagen, was wir da draußen sehen, habe mit Krise nichts zu tun, sei völlig normal. Kein Vergleich zum Winter achtundachtzig. Um nicht zu verhungern musste damals selbst der Moskauer, der mit befranster Lederweste überm Bierbauch von seinen drei Motorrädern schwärmt, im Wald Elche schießen gehen.
Es riecht nach hartgekochten Eiern und Krakauer. Frauen lösen zwischen Eierschalen und Wurstpellen Kreuzworträtsel. Ganz selbstverständlich tragen sie die gewaltigen Blumenmuster auf ihren Morgenröcken, ziehen an den Pritschen vorbei, zum Klo, zum Teekessel und wieder zurück, vorbei an schnarchenden, kahlgeschorenen Männerköpfen. Ich döse, bis plötzlich vor meiner Nase ein Fisch baumelt. Ich kralle mich an meinen klebrigen Rubeln fest, von links und rechts stapfen sie mit geräuchertem Fisch, Butter gefüllten Gläsern und in Zeitungspapier eingewickelten Nüssen an den Bettenlagern vorbei. Ein Mitreisender wettet, dass er für hundert Rubel, das sind drei Euro, eine lebende Ziege bekommt. Schneeweiß ist sie, kötelt und pisst vor Aufregung den ganzen Wagon voll. Eine Frau, die von ihrer Farm im Kaukasus erzählt, drückt sie sich zärtlich an den Hals. "Ich habe schon immer von einer kleinen Ziege geträumt." Die Zugpolizei stampft durch die Ziegenkötel, verlangt Pässe und holt einen Mann von seiner Liege. Er muss seine mit Wurstbroten und alten Socken gefüllte Tasche ausleeren.
Nach 36 Stunden sitzen die Haare der Frauen wie frisch gefönt. Eine Stunde vor unserer Ankunft in Vladikavkaz tauschen sie ihre Morgenröcke mit frisch gebügelten Blusen aus, die sie aus ihren Koffern zaubern, pudern und tuschen ihre Gesichter, malen die Lippen knallrot an.
Vladikavkaz. Die Häuser zerfallen, sie haben hoffnungslose, leere Gesichter wie ihre Bewohner. Zinn wurde hier mal geschmolzen und Silber raffiniert. Aber seit dem Zerfall der Sowjetunion haben sich die Fabrikgelände in unheimliche Geisterstädte verwandelt. In Vladikavkaz wird nur noch Schnaps gebrannt, erzählt Stanislavs Freund Arthur, der uns vom Bahnhof abholt. Das bringt Geld. Im Supermarkt gibt es alles zu kaufen, auch Becks und Joghurt von Ehrmann. Nur hundert Kilometer von Grozny entfernt. Arthur ist mit seiner Mutter und seinem Bruder aus der tschetschenischen Hauptstadt geflüchtet, die im Dezember 1999 in nur wenigen Tagen von den Russen dem Erdboden gleich gemacht worden ist: die erste komplett zerstörte Hauptstadt seit Warschau 1944.
Arthur begleitet Stanislav und mich zur Passstelle. Wer sich als Tourist nicht meldet, macht sich strafbar. Hinter dem Sperrholztresen zerren drei Damen in olivgrünen Tarnanzügen Blusen aus Plastiktüten und freuen sich laut lachend über ihre gerüschten Schnäppchen. Stanislav legt unsere Pässe auf das Sperrholz. Die Damen nehmen Haltung an, bewölken ihre Gesichter: "So kann ich Sie nicht registrieren, wo soll ich denn da hinstempeln?", donnert es aus dem dicksten der drei Tarnanzüge. Ich habe den Einreisezettel verloren, den mir am Moskauer Flughafen eine der Damen vom Zoll in den Reisepass gesteckt haben soll, ein kleines weißes Zettelchen, kaum größer als ein Kassenbon. "Und wo übernachten Sie? Suchen Sie sich erst mal ein Hotel!" Wir nehmen ein Zimmer mit taubenblau gestrichenen Wänden. Alles sauber, alles fein bewacht: Uniformen, die in der Lobby fern sehen; Uniformen, die vor dem Hotel rauchen oder mit Maschinengewehren den Verkehr regeln.
Wir laufen durch die Stadt, suchen ein Internetcafé. Die Leute bleiben stehen, drehen sich um, lachen uns aus. Eine riesige Stalin-Statue im Stadtpark scheint uns mit ihren Glubschaugen zu verfolgen. Ihre Augen bohren sich in unsere Rücken, bis wir die Stadt verlassen haben. Wir besuchen Arthur in Nazran, die Hauptstadt von Inguschetien, nicht weit von Vladikavkaz. Tanten, Onkel, Brüder, alle sind sie da, mästen uns mit Bergen von Rindfleisch, Gemüse, Käse, Kuchen und Geschichten von Bombenangriffen auf Grozny. Sie erzählen von Mord, Vergewaltigung und Folter, von ausgerissenen Fingernägeln, von abgerissenen Armen und Beinen, von neunzigtausend Tschetschenen, die seit vier Jahren in Flüchtlingslagern leben. Zum Abschied gibt’s drei Gläser mit eingemachtem Gemüse und Kompott.
Auf der Rückfahrt hocken wir stumm im Bus. Ich lasse mich fallen, träume von zu Hause, denke an den Basilikum, der auf meiner Küchenfensterbank vertrocknet. Stanislav packt seine Kamera aus, macht Aufnahmen durch das Rückfenster. Grau und verstaubt ist die Straße, ein paar Plastikflaschen und Tüten tanzen durch den fegenden Wind, ein Mann mit Fellmütze rührt mit einem dünnen Stock durch die Luft, brüllt irgendwas, vor ihm stolpern zehn Ziegenböcke über die Straße. Immer wieder öffnen sich Türen von scheinbar verlassenen Häusern, Frauen in Stöckelschuhen machen sich auf den Weg, dorthin wo es angeblich etwas zu kaufen gibt, kehren mit vollen Taschen zu ihren stummen Häusern zurück, kochen, trinken Tee und leben darin. Vor einem verlassenen Fabrikgelände hockt ein altes Ehepaar in einem Auto, auf der Motorhaube liegen in einem Korb ein paar rote Äpfel, die sie verkaufen wollen.
Plötzlich wird die Bustür aufgeschoben. Passkontrolle. Der Basilikum welkt weiter in meinem Hirn, während ich völlig unbeteiligt beobachte, wie Stanislav versucht, den Soldaten irgendetwas zu erklären. Nach fünf Minuten gibt er auf. "Die wollen uns mitnehmen." Ich öffne die Tür von einem weißen Lada, in dem uns ein Soldat aufs Polizeirevier bringen will. Stanislav redet und redet. Ich verstehe nichts, kann kein Russisch, gucke nach draußen, sehe die grauen Straßen vorbeiziehen, alles ganz normal. Warum schwitze ich nicht vor Angst? Ich sitze da, als ob uns ein netter Russe zu sich nach Hause eingeladen hat.
Auf dem Polizeirevier erwarten uns drei Männer. Sie lächeln. Alles wird gut, denke ich. Dann brüllen sie los, unsere Papiere seien nicht in Ordnung. Stanislav zeigt unsere Visa, alles da. Nein, es fehlen Papiere. Was wir in Vladikavkaz überhaupt zu suchen haben, wollen sie wissen. Wir sind Touristen, erzählt Stanislav, haben ein paar Freunde besucht. Dann fällt ihm der Einreisezettel ein, den die Damen in der Passstelle abgestempelt haben. Er zeigt ihn vor. Alles in Ordnung. Die Männer klopfen Stanislav auf die Schulter. Der Soldat, der uns zum Revier gefahren hat, begleitet uns zu seinem Wagen. Auf dem Beifahrersitz hocken noch die Einmachgläser mit unserem Gemüse und dem Kompott. "Haben wir von unseren Freunden geschenkt bekommen." Der Soldat lacht. Er schüttelt Stanislav die Hand, wünscht eine gute Reise, dreht sich zu mir um, starrt mich an: "Hat die eigentlich auch so einen Zettel?" Stanislav guckt verständnislos. "Na, den, den du uns gerade gezeigt hast. Hat die auch einen?" Stanislav wühlt in seinen Taschen. "Mitkommen", schnaubt der Soldat. Wir stolpern hinter ihm her und landen vor der Passstelle. Die Tarnanzüge, denke ich noch, da fängt der Soldat schon wie wild an, gegen das Fenster zu hämmern. Er ruft irgendetwas, doch keiner meldet sich.
Ich starre in den feisten Nacken des Soldaten, der nicht aufhören will, gegen die Scheibe zu trommeln. Der Nacken färbt sich rot. Der Soldat dreht sich um. Überlegt kurz und sagt dann ganz ruhig: "Okay, das war’s. Ihr könnt’ gehen." Tritt ab von der Bühne, hat keine Lust mehr, lässt uns mit rasenden Herzen stehen. Mit weichen Knien bewegen wir uns auf den Stadtpark, Stalin glotzt, allgegenwärtige Macht der Willkür. Erst als ich zwei Wochen später zu Hause meinen vertrockneten Basilikum in den Müll schmeiße, fühle ich mich wieder sicher.
Der Text ist urheberrechtlich geschützt.
zurück